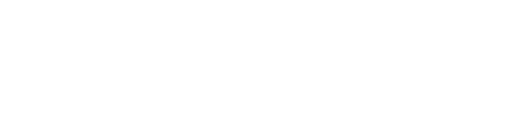Inhalt
Dieses Webinar gibt einen Praxiseinblick, wie Forschende mit den Daten des AMDCs arbeiten. Hier die Abstracts der Vorträge:
Vorstellung AMDC (Marie Beindl – AMDC):
Das Austrian Micro Data Center (AMDC) bietet seit seinem Start im Sommer 2022 die Möglichkeit zur Beforschung von verlinkbaren Mikrodaten. Forscher:innen von wissenschaftlichen Einrichtungen können im Zuge eines konkreten Forschungsvorhabens Zugang zu Registerdaten und Daten der öffentlichen Verwaltung bekommen. Durch den Remote Zugriff auf einen virtuellen Desktop und sorgfältige datenschutzrechtliche Prüfungen der Ergebnisse kann ein sicheres Arbeiten mit diesen Daten gewährleistet werden. Die Forschung mit Mikrodaten bietet innovative Potentiale für die Wissenschaft, vor allem durch die Verknüpfung verschiedener Datenquellen.
Versorgungsplanung im öffentlichen Verkehr? So geht’s mit Personendaten aus dem AMDC (Tadej Brezina – TU Wien):
Offizielle Pläne wie z.B. der österreichische Mobilitätsmasterplan 2030 sehen eine massive Veränderung des Mobilitätsverhaltens vor, um eine Verringerung des Klimawandels und die Anpassung an seine verbleibenden Auswirkungen zu erreichen. Dafür ist auch eine Planung verbesserter Dienstleistungen des öffentlichen Verkehrs zu Wohn- und Arbeitsorten notwendig. Die Verknüpfung von räumlichen Wohn- und Arbeitsortdaten auf Mikroebene mit den Daten der räumlichen ÖV-Versorgung (ÖV-Güteklassen) liefert einen Einblick darin, wie gut Menschen an unterschiedlichen Orten versorgt sind – oder auch nicht, wenn sie außerhalb der ÖV-Güteklassen wohnen und/oder arbeiten.
Epidemiologische Analysen mit verknüpften Registerdaten: Erkenntnisse aus mehreren AMDC Forschungsprojekten (Erwin Stolz – Med Uni Graz):
Umfassende Daten, die die ganze Bevölkerung eines Landes abbilden stellen eine wichtige Voraussetzung für hochwertige Forschung in den Sozialwissenschaften aber auch der Epidemiologie dar. Die Ergebnisse solcher Forschung kann einen Mehrwert für die Gesellschaft leisten und stärkt gleichzeitig den Forschungsstandort im internationalen Vergleich. Seit einiger Zeit ist es im Rahmen des Austrian Micro Data Center (AMDC) für Forscher*innen möglich, auch auf Daten der öffentlichen Register in Österreich zuzugreifen bzw. diese miteinander zu verknüpfen. Im Rahmen dieses Webinars stellt Prof. Erwin Stolz einige wissenschaftliche AMDC Projekte vor und berichtet praktische Erfahrungen aus der Registerdatenforschung.
Analyse des Arbeitskräftemangels mit Daten des AMDCs (Bettina Stadler – Uni Graz):
Der Arbeits- und Facharbeitskräftemangel wird in Österreich vielfach diskutiert. Obwohl es im Laufe des letzten Jahres in einigen Bereichen zu einer leichten Entspannung gekommen ist, haben viele Unternehmen nach wie vor große Probleme Mitarbeiter:innen zu finden. Mit Hilfe der Daten der Offenen-Stellen-Erhebung von Statistik Austria wird für den Zeitraum 2014 bis 2023 die Nachfrage von Unternehmen nach Arbeitskräften im Detail analysiert. Anschließend werden die Ergebnisse mit aus dem Labour Force Survey abgeleiteten Qualitätsindikatoren zusammengeführt. Die Daten der Offenen-Stellen Erhebung von Statistik Austria beruhen auf einer laufenden Stichprobe von Unternehmen und erfassen damit die Breite der offenen Stellen wesentlich besser als die Meldungen beim Arbeitsmarktservice.
Bridging Inequality in Distance and Gender: Commuting and Child Penalty in the Austrian Labor Market (Tobias Eibinger, Riccarda Rosenball – Uni Graz):
Die sogenannte „Child Penalty“ – die Verringerung von Einkommen und Karrieremöglichkeiten, die Frauen nach der Geburt eines Kindes erfahren – bleibt eine zentrale Ursache für Geschlechterungleichheit. Dieses Projekt konzentriert sich auf die geschlechtsspezifische Pendellücke, eine bisher wenig erforschte Dimension der „Child Penalty“. Mütter verkürzen nach der Geburt häufig ihre Pendeldistanzen, um Kinderbetreuung und Erwerbsarbeit besser vereinbaren zu können. Dies führt oft zu beruflichen Anpassungen, die langfristige Auswirkungen auf ihre Löhne und Karriereaussichten haben. Wir analysieren die Auswirkungen der Geburt eines Kindes auf das Pendelverhalten von Paaren, untersuchen die beruflichen Anpassungen, die Frauen vornehmen, um kürzere Pendelwege zu erreichen, und deren Auswirkungen auf die Löhne. Zudem bewerten wir, wie der Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten dazu beitragen kann, diese Unterschiede zu verringern.
Auf Basis umfangreicher administrativer Daten aus Österreich verknüpfen wir demografische, arbeitsmarktbezogene und Pendelinformationen aus dem Austria Micro Data Center (AMDC), einschließlich der Abgestimmten Erwerbs- und Registerzählung, der Integrierten Lohn- und Einkommenssteuerstatistik sowie der Statistik der Standesfälle einschließlich Todesursachenstatistik. Diese Datensätze enthalten detaillierte Informationen zu Demografie, Beschäftigung und Pendelstrecken, die mit Arbeitgeberinformationen verknüpft sind. Darüber hinaus integrieren wir gemeindebasierte Daten zur Kinderbetreuungsversorgung aus der Kindertagesheimstatistik.
Das Projekt bietet neue Erkenntnisse zur Verringerung von geschlechtsspezifischen Ungleichheiten im Pendelverhalten und in den Karriereergebnissen. Es wird aus Mitteln des Data:Research:Austria-Förderprogramms der Österreichischen Akademie der Wissenschaften finanziert.
Zeit und Ort:
01.04.2025, 10 – 12 Uhr, online
Sprache:
Deutsch
Vortragende:
Marie Beindl (AMDC), Tadej Brezina (TU Wien), Erwin Stolz (Med Uni Graz), Bettina Stadler (Uni Graz), Tobias Eibinger (Uni Graz), Riccarda Rosenball (Uni Graz), Thomas Rauter (Moderation – Med Uni Graz)
Materialien:
Die Materialien zum Webinar stehen hier zur Verfügung.